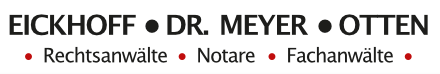- Haager Kindesentführungsabkommen: Über die Rückführung eines Kleinkinds in Krisengebiete
Internationale Kindesentführungen folgen in allen Staaten, die dem Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung (HKÜ) beigetreten sind, einer einfachen Regel: Schnellstens muss das Kind in das Land der Entführung zurück, damit dort gerichtlich über sein weiteres Schicksal entschieden werden kann. Doch was ist, wenn es sich wie im Fall des Oberlandesgerichts Stuttgart (OLG) dabei um ein Krisengebiet handelt?
In diesem Fall ging es um ein nicht einmal ein Jahr altes Kind eines griechisch-deutschen Elternpaars, das aus beruflichen Gründen in Israel lebte. Die Mutter flog heimlich mit dem Kind nach Deutschland, der Vater stellte bei der Behörde in Israel einen Antrag auf Rückführung.
Das OLG verurteilte die Mutter auch tatsächlich, das Kind innerhalb einer Woche nach Israel zurückzubringen, und drohte ihr bei Weigerung Ordnungsgeld und Ordnungshaft an. Zudem gab das Gericht dem Gerichtsvollzieher die Freigabe, das Kind nach Ablauf dieser Frist mit Durchsuchen der Wohnung und polizeilicher Hilfe abzuholen.
Zur Eskalation des Nahostkonflikts nahm das OLG wie folgt Stellung: Die Voraussetzungen der Härteklausel gemäß Art. 13 HKÜ können vorliegen, wenn das Kind in ein Kriegs- oder Bürgerkriegsgebiet zurückgeführt werden soll und dort eine konkrete Gefahr für das Kind bestehe. Allerdings gehören die in dem Herkunftsstaat herrschenden generellen Lebensbedingungen zum allgemeinen Lebensrisiko, das in der Regel hinzunehmen sei. Eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts führe nicht automatisch zur Annahme einer schwerwiegenden Gefahr. Bei der Prüfung der Frage, ob die maßgebliche Gefährdungsschwelle im vorliegenden Fall erreicht ist, hat das OLG berücksichtigt, dass die Sicherheitslage im Staat Israel schon seit langer Zeit angespannt sei und beide Elternteile im Jahr 2020 das Risiko, in Israel zu leben, als vertretbar angesehen und sich für einen Aufenthalt dort entschieden haben.
Hinweis: Die Ukraine betreffend hatte dasselbe OLG eine Rückführung abgelehnt und führte in seiner neuen Entscheidung aus, dass die Gefahrenlage in der Ukraine nicht mit der in Israel vergleichbar sei.
Quelle: OLG Stuttgart, Beschl. v. 23.05.2024 - 17 UF 71/24(aus: Ausgabe 07/2024)
- Kein Beschluss nach Aktenlage: Kinder müssen vom Familienrichter angehört werden
Über Kinder darf nicht wie über Sachen - also nie nach Aktenlage - entschieden werden. Das Gericht muss sich stets einen persönlichen Eindruck vom betroffenen Kind verschaffen und es kennenlernen. Weil es daran mangelte, hob das Oberlandesgericht Karlsruhe (OLG) die Entscheidung eines Familienrichters als verfahrensfehlerhaft auf und gab ihm auf, die erforderliche Anhörung nachzuholen.
Es ging um einen unstreitig alkoholkranken Vater, der rückfällig geworden war. Jemand hatte anonym eine Kindeswohlgefährdung beim Jugendamt gemeldet, das bei einem Hausbesuch das Kind dann auch in Obhut nahm. Im Verfahren behauptete der Vater, er sei nun abstinent und könne das Kind versorgen. Außerdem wolle das Kind auch wieder bei ihm wohnen. Von seiner Abstinenz war das Gericht jedoch nicht überzeugt. Es käme wegen der objektiven Kindeswohlgefährdung auf den Kindeswillen sowieso nicht an - und so veranlasste der Richter auch keine Anhörung des Kindes.
Laut OLG ist die persönliche Anhörung des Kindes jedoch zwingend. Sie dient auch dem Verschaffen eines Eindrucks von dem Kind durch das Familiengericht, um daraus Rückschlüsse auf dessen Befindlichkeit, Wünsche, Neigungen und Bindungen zu ziehen. Das OLG habe daher die Aufgabe, das Verfahren unter Berücksichtigung des Alters, des Entwicklungsstands und der sonstigen Fähigkeiten des Kindes so zu gestalten, dass das Kind seine persönlichen Beziehungen zu den Eltern erkennbar werden lassen kann. Sollte tatsächlich, wie das erstinstanzliche Gericht mutmaßt, der Wille des Kindes mit dessen Wohl nicht in Einklang zu bringen sein, ist dies in der Entscheidung zu begründen. Das Gericht hat von vornherein die Pflicht, den Kindeswillen im Rahmen der Amtsermittlung zu erforschen. Denn dieser sei zu berücksichtigen, soweit das mit Kindeswohl vereinbar ist. Eine angemessene Berücksichtigung findet der Kindeswille selbst dann, wenn er gegen andere Kindeswohlkriterien abgewogen und ihm im Ergebnis nicht nachgekommen wird.
Hinweis: Seit Juni 2021 gilt die Anhörungspflicht unabhängig vom Alter des Kindes. Eine Unterscheidung nach dem Kindesalter hielt der Gesetzgeber im Hinblick darauf für nicht erforderlich, dass die Fähigkeiten eines Kindes, einen eigenen Willen zu entwickeln und im Verfahren zum Ausdruck zu bringen, individuell verschieden und nicht vom Alter des Kindes abhängig sind. Bereits zuvor war die Anhörung von Kindern jedenfalls ab einer Altersgrenze von drei Jahren als erforderlich erachtet worden.
Quelle: OLG Karlsruhe, Beschl. v. 20.02.2024 - 18 UF 221/23(aus: Ausgabe 07/2024)
- Klageweg vereinfacht: BGH ändert seine Rechtsprechung zum Kindesunterhalt im Wechselmodell
Im "echten Wechselmodell", bei dem Kinder getrennt lebender Eltern sich hälftig in beiden Haushalten aufhalten, war es bislang kompliziert, Unterhalt einzuklagen. Der "Wenigerverdiener", dem ein Ausgleich zustünde, musste sich dafür erstmal das Recht durch ein vorgeschaltetes Sorgerechtsverfahren verschaffen, in dem das Gericht alternativ einen neutralen Ergänzungspfleger für den Aufgabenkreis "Unterhalt" einsetzen kann. So war es bislang auf Basis einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH).
2024 hat der BGH diese Rechtsprechung aufgegeben und in einer Fallgestaltung unverheirateter Eltern (für Geschiedene muss das Gleiche gelten) die Tür dafür geöffnet, ohne dieses Vorverfahren auszukommen. Im Fall eines Wechselmodells sind jetzt beide - nicht miteinander verheirateten - Eltern in der Lage, direkt den Unterhalt einzuklagen. Das Kind ist dann der Antragsteller - vertreten durch einen Elternteil -, und beide Eltern können Gegner sein. Es war bisher undenkbar, dass auf diese Weise ein Elternteil quasi auf beiden Seiten des Verfahrens steht.
Der BGH hält das nun für zulässig, weil es sich bei den gegen die Eltern als Teilschuldner (§ 1606 Bürgerliches Gesetzbuch) gerichteten Unterhaltsansprüchen um verschiedene Verfahrensgegenstände handelt. Zur Ermöglichung der abschließenden Klärung des gesamten Unterhalts in einem Verfahren sei das verfahrensökonomisch.
Hinweis: Bevor der BGH seine Entscheidung vom 10.04.2024 veröffentlicht hatte, kam das Oberlandesgericht Nürnberg zum selben Ergebnis (Beschl. v. 23.05.2024 - 10 WF 168/24).
Quelle: BGH, Beschl. v. 10.04.2024 - XII ZB 459/23(aus: Ausgabe 07/2024)
- Sorgerechtsentzug keine Lösung: Wenn Kinder den Kontakt zu einem Elternteil verweigern
Streiten sich Eltern so sehr, dass die Beziehung "hochkonflikthaft" genannt wird, wissen Gerichte oft keinen besseren Rat zum Schutz der Kinder, als den Kontaktabbruch zum Umgangselternteil zu akzeptieren. So war es im Fall des Oberlandesgerichts Köln (OLG). Hier waren die beiden Söhne vom Haushalt der Mutter in den des Vaters gewechselt und verweigerten nun den Kontakt zur Mutter.
Seit der Trennung 2021 hatte es bereits neun Gerichtsverfahren zwischen den Eltern gegeben - mit einer Reihe an Vorwürfen. Die Folgen: Das Jugendamt hatte eine Familienhilfe eingesetzt, ein Umgangspfleger sollte für reibungslose Kontakte sorgen, ein familienpsychologisches Gutachten wurde eingeholt. Der Vater verweigerte die Zusammenarbeit mit der Gutachterin und der Verfahrensbeiständin und schirmte die Kinder von diesen ab. Die Gutachterin musste daher nach Aktenlage bewerten, dass sich die Kinder in einem massiven Loyalitätskonflikt befänden. Auch wenn das Verhalten des Vaters, die Mutter absolut auszugrenzen, langfristig ihre Entwicklung gefährden könne, könnten erzwungene Umgangskontakte dieses Entwicklungsrisiko nicht mindern. Kontakte zur Mutter könnten also derzeit nicht stattfinden. Der Aufgabenkreis "Umgang" könne daher auf einen Ergänzungspfleger übertragen werden, der im Kontakt mit den Kindern den Zeitpunkt für eine Anbahnung ermitteln könne.
Das Amtsgericht entzog dem Vater daraufhin das Sorgerecht für den Aufgabenkreis "Umgang" und setzte das Jugendamt hierfür als Umgangspfleger ein. Sein Verhalten - nämlich die fehlende Kooperation mit sämtlichen Verfahrensbeteiligten - begründe eine Kindeswohlgefährdung, da somit eine weitere Aufklärung in der Sache verhindert werde und Umgänge der Kinder mit der Kindesmutter nicht stattfinden könnten.
Das OLG gab dem Vater das Sorgerecht zurück. Es war davon überzeugt, dass die Jungen die Kontaktverweigerung selbst als einzige Lösungsmöglichkeit sehen, um zur Ruhe zur kommen. Alles spreche dafür, dass sie in ihrem Loyalitätskonflikt befürchten würden, dass ihre Bewältigungsstrategien zusammenbrechen, wenn sie sich der Auseinandersetzung mit der Beziehung zu beiden Eltern stellen müssen. Der von den beiden Jungen geäußerte Wille sei stabil und beruhe auf ihren inneren Bindungen. Deshalb komme es nicht darauf an, ob dieser Wille auch durch das Verhalten des bindungsintoleranten Kindesvaters zustande gekommen ist. Zudem sei der Entzug des Sorgerechts kein geeignetes Mittel, die Meinung der Kinder zu verändern.
Hinweis: Der geäußerte Wille von Kindern wird auch dann beachtet, wenn er ursprünglich durch Manipulation entstanden ist, inzwischen aber vom Kind als eigener Wille empfunden wird. Schwierig ist die Beurteilung, ob die Kinder aus Angst vor Liebesentzug oder Sanktionen etwas anderes sagen, als sie sich eigentlich wünschen.
Quelle: OLG Köln, Beschl. v. 16.05.2024 - 14 UF 22/24(aus: Ausgabe 07/2024)
- Statistik des Bundesfamilienministeriums: Familienreport zeigt Lebenslagen von Familien auf
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat im Mai 2024 mit dem "Familienreport" seine Auswertung amtlicher Statistiken, wissenschaftlicher Studien und repräsentativer Bevölkerungsumfragen veröffentlicht.
Daraus einige Erkenntnisse:
- Personen mit Kindern im Haushalt sind insgesamt zufriedener als Personen ohne eigene Kinder.
- In Ostdeutschland leben im Vergleich zu Westdeutschland mehr Alleinerziehende (25 % versus 19 %) und mehr unverheiratete Eltern (21 % versus 10 %).
- Die Betreuungsquote der unter Dreijährigen in Kindertagesbetreuungen ist erneut gestiegen (36,4 % im Jahr 2023) - im Vergleich zum Jahr 2006 hat sie sich fast verdreifacht.
- Eltern verbringen mehr Zeit mit ihren Kindern als noch vor zehn Jahren (Väter + 28 Minuten/Tag; Mütter: + 33 Minuten/Tag).
- Trotz der zunehmenden Bereitschaft der Väter, Verantwortung zu übernehmen, schultern weiterhin die Mütter den Großteil der Kinderbetreuung.
- Viele Eltern wünschen sich eine partnerschaftliche Aufgabenteilung bei Familie und Beruf. Es gelingt ihnen aber häufig nicht, dies in die Realität umzusetzen. 75 % der Mütter in Paarfamilien übernehmen den Großteil der Kinderbetreuung, aber nur 48 % finden das ideal.
- Elternpaare, die Sorge- und Erwerbsarbeit partnerschaftlich aufteilen, berichten deutlich häufiger über ein gutes Familienklima, enge Beziehungen zwischen Eltern und Kindern und gegenseitige Unterstützung.
- Väter sind heute seltener Alleinverdiener als früher. Der Anteil der Familien mit einem traditionellen Alleinverdienermodell ist von 33 % (2008) auf 26 % (2022) zurückgegangen. Der Anteil der erwerbstätigen Mütter ist im selben Zeitraum von 63 % auf 69 % gestiegen
Quelle: BMFSFJ, Pressemitteilung Nr. 024 v. 14.05.2024, www.bmfsfj.de(aus: Ausgabe 07/2024)
 Im Familienrecht sind die Rechtsverhältnisse von Personen geregelt, die aufgrund von Ehe, Lebenspartnerschaft und Verwandtschaft miteinander verbunden sind.
Im Familienrecht sind die Rechtsverhältnisse von Personen geregelt, die aufgrund von Ehe, Lebenspartnerschaft und Verwandtschaft miteinander verbunden sind.