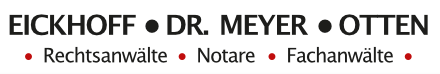Verkehrsrecht
 Wir vertreten Sie im Verkehrsrecht:
Wir vertreten Sie im Verkehrsrecht:
Autokauf
Probleme bei dem An- oder Verkauf eines Pkws mit dem Vertragspartner?
Geschwindigkeitsverstöße, Abstand unterschritten,
rote Ampel, etc.?
Ihnen wird zur Last gelegt, eine Geschwindigkeitsüberschreitung oder einen anderen Bußgeld bewährten Verstoß begangen zu haben?
Verkehrsunfallabwicklung
Sie hatten einen Verkehrsunfall?
Fahrerlaubnis entzogen/droht eine MPU?
Es gibt Probleme mit Ihrem Führerschein?
In all diesen Problembereichen sollten Sie sich anwaltlicher Hilfe bedienen. Hierfür stehe ich als Fachanwalt für Verkehrsrecht gerne zur Verfügung.:
Zum Thema Verkehrsrecht
- Anspruchskürzung möglich: Auch 2021 gehört Schutzkleidung nicht zum allgemeinen Verkehrsbewusstsein von Bikern
- Beweis des ersten Anscheins: Erfahrungswerte gehen grundsätzlich vom Alleinverschulden des Auffahrenden aus
- Fußgänger auf Radweg: Keine Prozesskostenhilfe bei aussichtsloser Rechtsverteidigung nach selbstverschuldeten Unfall
- Kein Strafklageverbrauch: Keine innere Verknüpfung von zeitgleichem Fahren ohne TÜV und ohne Fahrerlaubnis
- Wissenschaftliche Empfehlung: Gericht setzt THC-Grenzwert beim Führen eines Kfz auf 3,5 ng/ml THC fest
Was ist eine sommerliche Motorradtour wert, wenn diese grenzenlose Freiheit in Leder und Gummi gezwängt wird? Die Antwort des Oberlandesgerichts Celle (OLG) mag trösten, doch Vorsicht: Andere Gerichte vertreten eine andere Auffassung, wenn es um die Frage geht, welche Verletzungen im Ernstfall durch eine angemessene Schutzkleidung hätten vermieden werden können.
Im Jahr 2021 fuhr der Kläger mit seinem Motorrad hinter einem landwirtschaftlichen Gespann. Trotz Überholverbots überholte er dieses Gespann. Während des Überholvorgangs kam es zur Kollision, weil der Fahrer des Gespanns nach links in eine Einmündung abbog. Bei dem Unfall verletzte sich der Kläger. Die gegnerische Haftpflichtversicherung wendete ein, dass die Verletzungsfolgen durch das Tragen von Motorradschutzkleidung - insbesondere einer Motorradhose - entweder gar nicht erst eingetreten oder eben nicht derart schwerwiegend ausgefallen wären.
Das OLG gab der Klage zu 50 % statt. Das Gericht nahm dabei ein Mitverschulden des Klägers an, weil er trotz Überholverbots überholte. Daneben sah der Senat allerdings auch eine Mithaftung beim Fahrer des Gespanns, weil dieser vor dem Abbiegen gegen seine doppelte Rückschaupflicht verstoßen habe. Zudem sei bei seinem Gespann von einer erhöhten Betriebsgefahr auszugehen.
Bezüglich des Arguments der Beklagten, die Verletzungsfolgen wären durch das Tragen von Schutzkleidung, insbesondere einer Motorradhose, gemindert gewesen oder gar vermieden worden, wies das OLG darauf hin, dass keine gesetzliche Regelung für das Tragen von Motorradschutzkleidung existiere. Der Bundesgerichtshof habe 1979 festgestellt, dass grundsätzlich maßgeblich ist, ob und inwieweit ein allgemeines Verkehrsbewusstsein besteht, zum eigenen Schutz bestimmte Schutzkleidung zu tragen. Recherchen des Senats haben ergeben, dass im Jahr 2021 nur 45,9 % der Motorradfahrer neben einem Helm weitere Schutzkleidung getragen haben, komplette Schutzkleidung dagegen nur 24,6 %. Daher könne auch für 2021 nicht von einem allgemeinen Verkehrsbewusstsein für das Tragen von Motorradschutzkleidung - insbesondere einer Motorradhose - ausgegangen werden.
Hinweis: Ob das Nichttragen von Motorradschutzkleidung als Anspruchskürzung zu berücksichtigen ist, wird in der Rechtsprechung unterschiedlich behandelt. So vertreten einige Gerichte durchaus die Auffassung, dass das Nichttragen von Motorradschutzkleidung ein Mitverschulden des Geschädigten begründet, wenn hierdurch Verletzungen vermieden oder vermindert worden wären. Einigkeit besteht nur darüber, dass das Nichttragen von Motorradschuhen kein Mitverschulden begründet. Das Gericht muss entscheiden, ob der Verletzte die Sorgfalt außer Acht lässt, die ein ordentlicher und verständiger Mensch zur Vermeidung eigenen Schadens anzuwenden pflegt.
Quelle: OLG Celle, Urt. v. 13.03.2024 - 14 U 122/23
| zum Thema: | Verkehrsrecht |
(aus: Ausgabe 07/2024)
"Es kommt darauf an" ist eine Art erstes Gebot in der juristischen Bewertung von Sachverhalten. Dagegen spricht der sogenannte Anscheinsbeweis, der sich auf Erfahrungswerte aus ähnlich gelagerten Fällen speist. Wer sich auf den erstgenannten Grundsatz stützen will, braucht stichhaltige Beweise, an denen es dem Beklagten eines Auffahrunfalls fehlte, der vor dem Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht (OLG) stand.
Die Tochter der Klägerin befuhr innerorts eine Straße. An einer Kreuzung musste sie als erstes Fahrzeug an der Ampelanlage anhalten. Diese zeigte sowohl für den Geradeausverkehr als auch für Rechtsabbieger Rot. Nachdem die Tochter der Klägerin wieder angefahren war, bremste sie nach Überfahren der Haltelinie vollständig ab - warum, blieb unklar. Klar allerdings war, dass der hinter ihr fahrende Beklagte auf ihr Fahrzeug auffuhr.
Das OLG nahm eine Haftungsverteilung von 80 zu 20 zugunsten der Klägerin an. Gegen den Beklagten spreche der Beweis des ersten Anscheins dafür, dass er den Unfall allein verschuldet habe. Von einem atypischen Geschehensablauf könne nicht ausgegangen werden. Um den Anscheinsbeweis für ein Verschulden des Auffahrenden zu erschüttern, genüge es nicht, dass der Voranfahrende in der Anfangsphase grundlos abbremst. Voraussetzung ist vielmehr, dass ein "starkes Abbremsen" nachgewiesen werde, das über das Maß eines normalen Bremsvorgangs hinausgeht. Und eben dies konnte im hiesigen Fall nicht festgestellt werden. Hierbei berücksichtigte der Senat auch, dass das Klägerfahrzeug gerade erst angefahren war und somit ein starkes Abbremsen gar nicht möglich gewesen wäre. Dessen Halterin muss sich allerdings eine Mithaftung aus der Betriebsgefahr von 20 % anrechnen lassen.
Hinweis: Nach starkem Abbremsen ohne zwingenden Grund kann trotz grünem Ampellicht eine alleinige Haftung des Abbremsenden in Betracht kommen. Ein starkes Abbremsen ohne zwingenden Grund muss der Auffahrende allerdings beweisen können, da im gleichgerichteten Verkehr grundsätzlich von einem Alleinverschulden des Auffahrenden aufgrund des gegen ihn sprechenden Anscheinsbeweises auszugehen ist.
Quelle: Schleswig-Holsteinisches OLG, Urt. v. 19.03.2024 - 7 U 82/23
| zum Thema: | Verkehrsrecht |
(aus: Ausgabe 07/2024)
Der Straßenverkehr ist eine Art Spiegel gesellschaftlicher Schieflagen. Auch der folgende Fall zeigt, dass alles einfacher wäre, würden sich alle an bestehende Regeln halten und zudem jene Rücksicht nehmen, die sie selbst auch erwarten. Das Brandenburgische Oberlandesgericht (OLG) musste im folgenden Fall zuerst die prozessualen Erfolgsaussichten abwägen, um über eine begehrte Prozesskostenhilfe (PKH) zu entscheiden.
Ein Fußgänger, der spätere Beklagte, trat auf einen Radweg, ohne auf den dortigen Radverkehr zu achten. Es kam, wie es kommen musste, um als Fall hier behandelt zu werden: zur Kollision mit einem Radfahrer. Der Radfahrer verlangte in der Folge Schadens- und Schmerzensgeld von dem Fußgänger. Dieser Beklagte beantragte seinerseits für das gerichtliche Verfahren PKH. Doch dieses Ansinnen hatte in den Augen des zu entscheidenden Gerichts keinerlei Aussicht auf Genehmigung.
Das OLG hat durch Beschluss den Antrag zurückgewiesen. Zur Begründung führt das Gericht aus, dass die Rechtsverteidigung des Beklagten keinerlei Aussicht auf Erfolg habe. Der Beklagte habe den Unfall allein schuldhaft verursacht. Zwar ist der Radweg kein Bestandteil der Fahrbahn - dennoch handelt es sich durchaus um einen durch Verkehrszeichen oder seine bauliche Gestaltung als solchen erkennbaren Sonderweg. Und dessen Benutzung ist primär Radfahrern vorbehalten. Fußgänger, die einen Radweg überqueren wollen, müssen folglich auf die Radfahrer Rücksicht nehmen. Ein Fußgänger darf einen Radweg erst betreten, wenn er davon überzeugt sein kann, dass er keinen Radfahrer gefährdet oder an dessen Weiterfahrt behindert. Ein Mitverschulden des Fahrradfahrers konnte hier nicht festgestellt werden. Insbesondere musste der Radfahrer seine Geschwindigkeit auch nicht auf die Möglichkeit einrichten, dass ein Fußgänger vor ihm auf die Fahrbahn treten wird.
Hinweis: Beim Überqueren eines Radwegs müssen Fußgänger auf die Radfahrer Rücksicht nehmen. Sie dürfen einen Radweg erst dann überqueren, wenn eine Behinderung ausgeschlossen ist (§ 25 Abs. 3 Straßenverkehrs-Ordnung). Laut statistischem Bundesamt ereigneten sich im Jahr 2021 rund 85.000 Fahrradunfälle, wobei E-Bikes oder Pedelecs an 17.000 Unfällen beteiligt waren.
Quelle: Brandenburgisches OLG, Beschl. v. 12.03.2024 - 12 W 7/24
| zum Thema: | Verkehrsrecht |
(aus: Ausgabe 07/2024)
Steht eine Verurteilung in einer Bußgeldsache einer weiteren Verurteilung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen, wenn beide Taten zeitgleich im selben Fahrzeug verwirklicht werden? Das Amtsgericht Kaiserslautern (AG) meinte ja - das Oberlandesgericht Zweibrücken (OLG) sah das jedoch anders.
Der Angeklagte hatte im Dezember 2022 mit seinem Pkw am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Bei einer Verkehrskontrolle wurde zudem festgestellt, dass der Angeklagte den Termin zur Vorführung seines Fahrzeugs zur Hauptuntersuchung (HU) überschritten hatte. Daher wurden sowohl ein Strafverfahren als auch ein Bußgeldverfahren gegen den Angeklagten eingeleitet. Das AG hatte den Angeklagten wegen einer Ordnungswidrigkeit des fahrlässigen Überschreitens des Termins zur Vorführung zur HU in dem Bußgeldverfahren zu einer Geldbuße von 60 EUR verurteilt. Das Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde durch das AG jedoch eingestellt, da es davon ausgegangen ist, dass durch die Verurteilung in der Bußgeldsache in der Strafsache ein sogenannter Strafklageverbrauch eingetreten sei - niemand darf wegen einer Tat mehrmals abgeurteilt werden.
Auf die Revision der Staatsanwaltschaft hat das OLG das nun Urteil aufgehoben und das Verfahren zur erneuten Verhandlung an das AG zurückverwiesen. Zur Begründung hat der Senat ausgeführt, dass das in der Bußgeldsache ergangene Urteil der Verfolgung des Vorwurfs des Fahrens ohne Fahrerlaubnis nicht entgegenstehe. Die Ausführungshandlungen der beiden Delikte deckten sich nicht einmal teilweise. Bei der Ordnungswidrigkeit habe der Angeklagte in seiner Funktion als Kfz-Halter den Entschluss gefasst, einer gesetzlichen Handlungspflicht nicht nachzukommen. Sein Entschluss für das Fahren ohne Fahrerlaubnis beruhe hingegen auf einem gesondert gefassten Tatentschluss. Eine sogenannte "innere Verknüpfung" beider Handlungen, die über eine bloße punktuelle Gleichzeitigkeit hinausgehe, liege daher nicht vor.
Hinweis: Sogenannte materiell-rechtlich selbständige Taten sind meist auch prozessual selbständig, falls nicht besondere Umstände die Annahme einer Tat rechtfertigen. Letzteres wird angenommen, wenn die Handlungen innerlich stark miteinander verknüpft sind, so dass nur ihre gemeinsame Würdigung sinnvoll und möglich ist, während eine getrennte Würdigung sowie Aburteilung in verschiedenen Verfahren als unnatürliche Aufspaltung eines einheitlichen Lebensvorgangs empfunden werden würde.
Quelle: OLG Zweibrücken, Urt. v. 29.01.2024 - 1 ORs 1 SRs 16/23
| zum Thema: | Verkehrsrecht |
(aus: Ausgabe 07/2024)
Da ist er - unser erster Fall in Sachen THC-Grenzwert. Dabei war es am Amtsgericht Dortmund (AG), eine Entscheidung zu treffen, ob der bisherige Grenzwert von einer neuen Zahl abgelöst wird - und wenn ja, von welcher und von wem festgelegt. Wie dem Hinweistext zu entnehmen, wird es hierzu nicht nur juristische Meinungsverschiedenheiten, sondern auch Diskussionen um prinzipielle Grundhaltungen und Umsetzungsformen geben.
Der Sachverhalt ist kurz und knapp dargelegt: Dem Betroffenen wurde vorgeworfen, vor dem 01.04.2024 einen Pkw geführt zu haben, obwohl er unter der Wirkung berauschender Mittel gestanden habe. Eine Blutprobe hatte ihm eine THC-Konzentration von 3,1 ng/ml nachgewiesen.
Das AG hat den Betroffenen freigesprochen. Der bisherige Grenzwert habe zwar bei 1,0 ng/ml gelegen - dieser gelte seit dem 01.04.2024 mit Inkrafttreten des Konsumcannabisgesetzes aber nicht mehr. In der Anlage zu § 24a Straßenverkehrsgesetz (StVG) werde lediglich das Wirkungsverbot von THC genannt, nicht aber ein im Straßenverkehr maßgeblicher Grenzwert. Dieser sei in der Vergangenheit von der Rechtsprechung anhand rechtsmedizinischer Vorschläge festgesetzt worden.
Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die nunmehr den Grenzwert 3,5 ng/ml vorgeschlagen habe. Dazu hieß es in der Pressemitteilung des Ministeriums: "Die wissenschaftlichen Experten geben folgende Empfehlung ab: Im Rahmen des § 24a StVG wird ein gesetzlicher Wirkungsgrenzwert von 3,5 ng/ml THC-Blutserum vorgeschlagen. Bei Erreichen dieses Grenzwertes ist nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft eine verkehrssicherheitsrelevante Wirkung beim Führen eines Fahrzeugs nicht fernliegend, aber deutlich unterhalb der Schwelle, ab der ein allgemeines Unfallrisiko liegt." Das AG sieht in dieser Form der Stellungnahme ein antizipiertes Sachverständigengutachten. Es seien auch keine weiteren Schritte für die Umsetzung des Grenzwerts in die verkehrsrechtliche Praxis vorgesehen.
Hinweis: Für die Praxis ist diese Entscheidung wesentlich, da die darin enthaltene Argumentation auf alle noch offenen Cannabisordnungswidrigkeitsverfahren anwendbar sein dürfte. Anders als das AG hat aber das - Überraschung - Bayerische Oberste Landesgericht in einem Beschluss vom 02.05.2024 (202 ObOWi 374/24) entschieden. Der Senat vertrat die Auffassung, dass nach derzeit unverändert gültiger Rechtslage keine Veranlassung bestehe, von dem sogenannten analytischen Nachweisgrenzwert für THC bzw. Cannabisprodukte von 1 ng/ml THC im Blutserum abzuweichen.
Quelle: AG Dortmund, Urt. v. 11.04.2024 - 729 OWi-251 Js 287/24 - 27/24
| zum Thema: | Verkehrsrecht |
(aus: Ausgabe 07/2024)